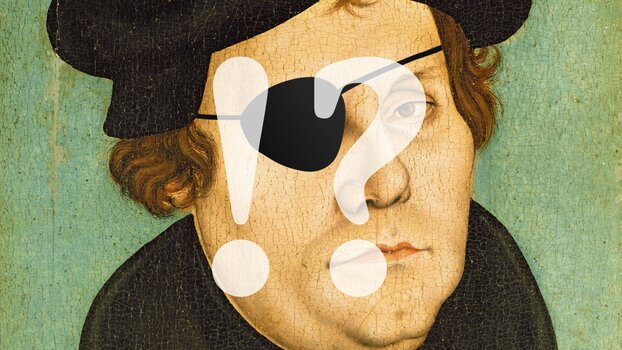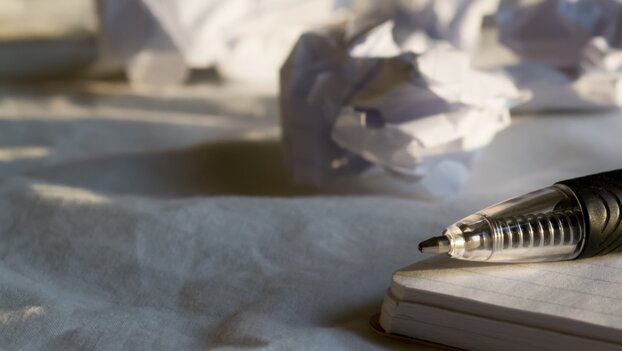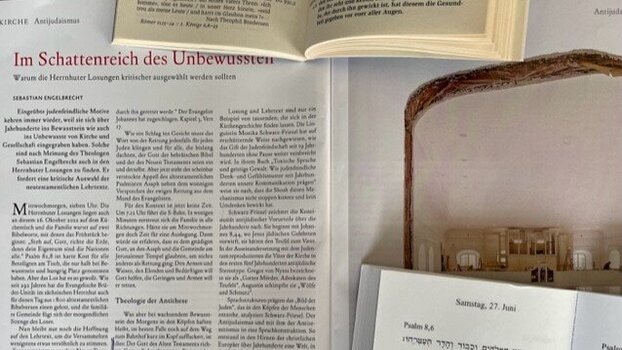Matt Botsford auf Unsplash
Manchmal reicht zu einem Thema nicht nur ein Spruch - dann ist es Zeit für den VELKD-Einspruch: Theologische fundierte Positionen oder auch persönliche Meinungen zeichnen diese Rubrik aus. In loser Folge melden sich hier Autoren zu Wort, die zu aktuellen Anlässen etwas zu sagen haben.
Herwig Prammer / Staatsoper Berlin
Lukas Cranach der Ältere / Montage: VELKD
Frank Hofmann
Steve Johnson auf Unsplash
Frank Hofmann
NASA auf Unsplash
VELKD
Frank Hofmann
C D-X auf Unsplash