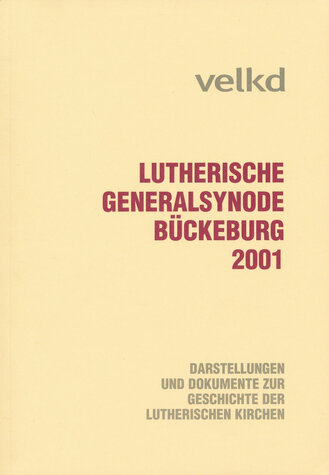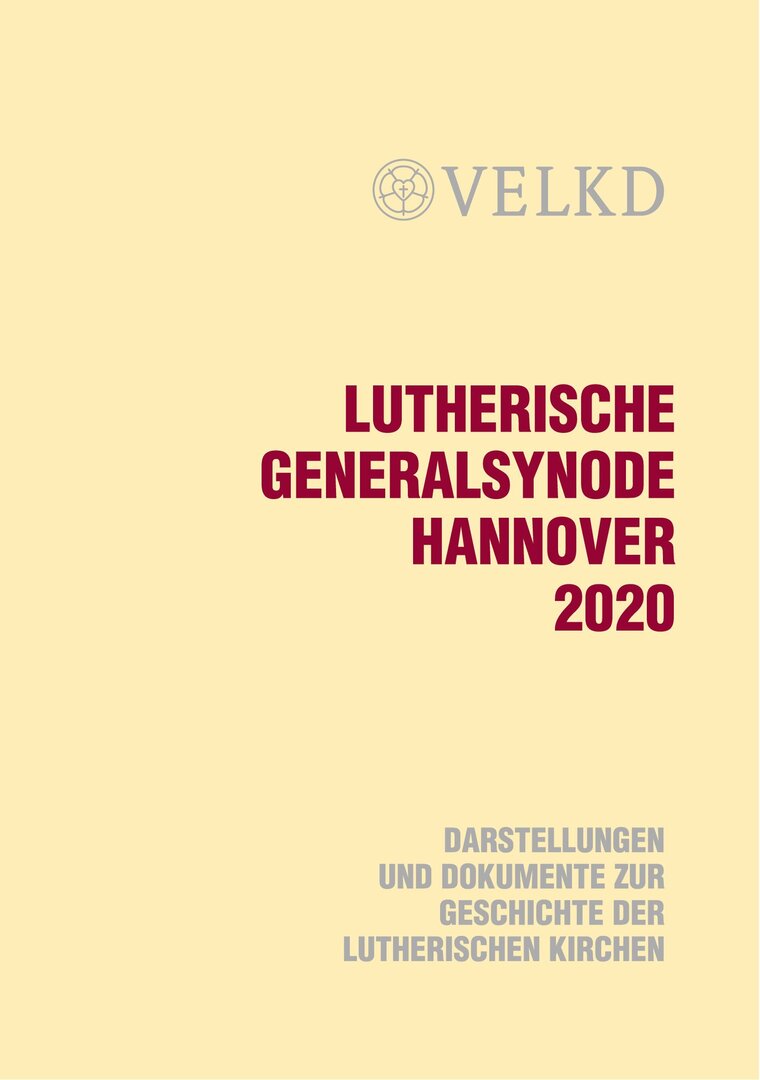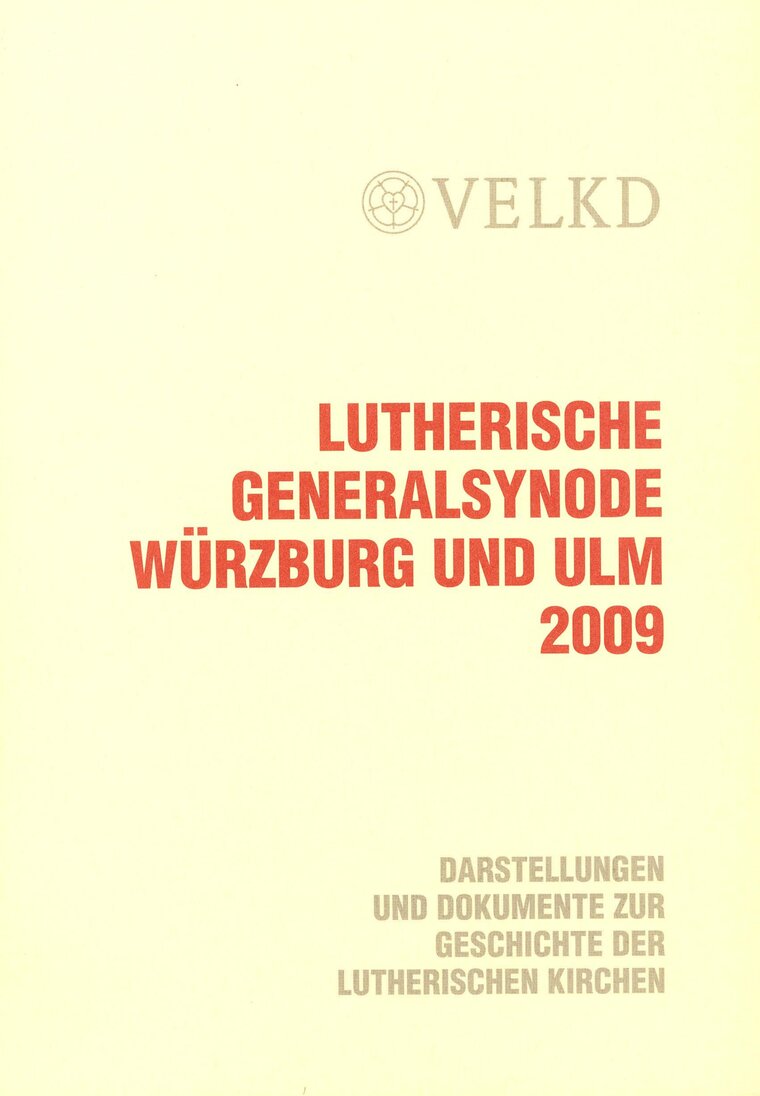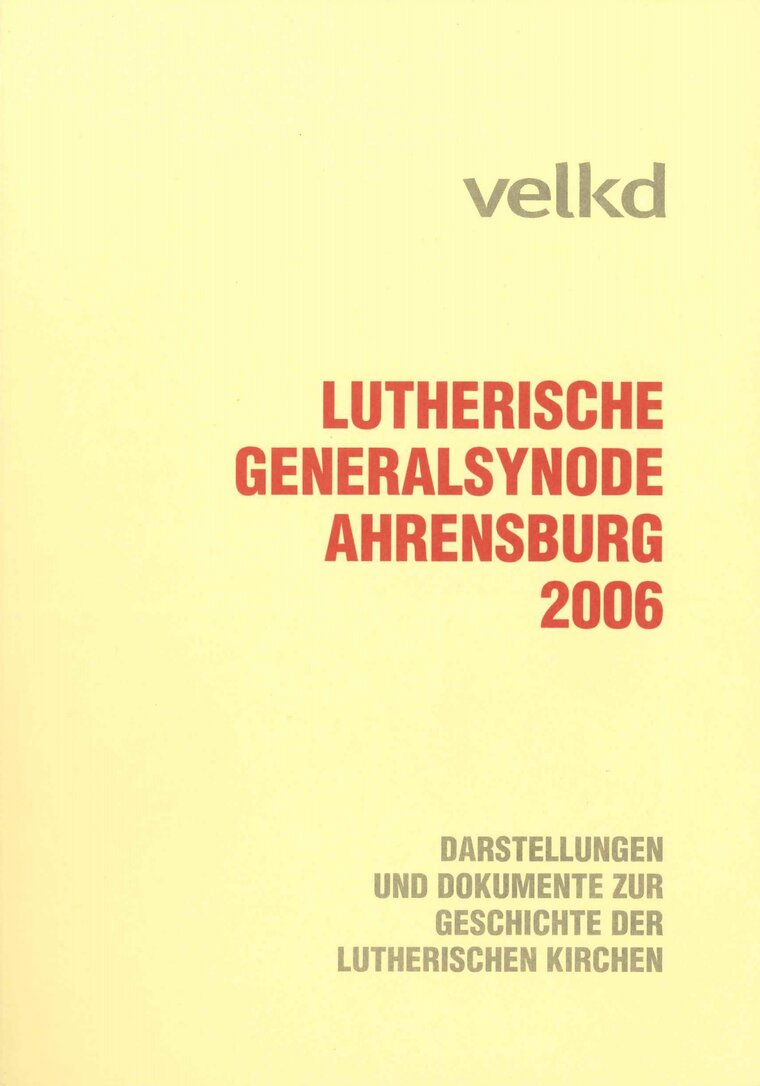Lutherische Generalsynode Bückeburg 2001
Darstellungen und Dokumente zur Geschichte der Lutherischen Kirchen
Bericht über die fünfte Tagung der neunten Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 20.bis 23. Oktober 2001 in Bückeburg
- Reihe
- Protokollbände der Generalsynode
- Ausführung
- Paperback
- Sprache
- Deutsch
- Seitenzahl
- 322
- Format
- 14,8 x 21,0 cm
- Veröffentlichungsjahr
- 2002
- Verlag
- Lutherisches Verlagshaus, Hannover
Der niedersächsische Ministerpräsident Sigmar Gabriel (SPD), hat auf der 5. Tagung der 9. Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) angeregt, vor dem Hintergrund der Terroranschläge in den USA nicht nur über militärische Gewalt und staatliche Instrumente zur Stärkung der inneren Sicherheit zu sprechen, sondern auch über das Scheitern und die daraus folgenden Konsequenzen der Integration von Menschen in unserer Gesellschaft. In seinem Grußwort vor der Generalsynode, die vom 20. bis 23. Oktober 200 I in Bückeburg unter dem Thema "Evangelisches Profil als Ausdruck von Freiheit und Verbindlichkeit" tagte, forderte Gabriel zu einer “kulturellen Auseinandersetzung” in Deutschland, zu einem Dialog der Kirchen und Religionsgemeinschaften über Begriffe wie "Freiheit" und "Verbindlichkeit" auf. Man habe, so der Politiker, "neben all den
Schwierigkeiten mit Terrorismus, Kriminalität, Hunger und Elend auf dieser Welt bei uns auch zu lange Parallelgesellschaften zugelassen, nicht etwa aus Toleranz, sondern ganz häufig aus Bequemlichkeit."
Nach Auffassung des Leitenden Bischofs der VELKD, Bischof Dr. Hans Christian Knuth (Schleswig), hat die Frage nach der ethischen Orientierung in Deutschland sowie weltweit "an Brisanz" gewonnen. "Unübersehbarer Orientierungsbedarf' besteht nach Knuths Einschätzung bei den Themen Gentechnik, Sterbehilfe sowie Gewalt, was sich nicht nur auf die Terroranschläge des 1 1 . September beziehe, sondern auch auf eine "starke Anfalligkeit für Gewaltausübung, Rechtsradikalismus und Fremdenhass" in Deutschland. Für die Behandlung ethischer Fragen sei jedoch kennzeichnend, "dass es eine selbstverständliche Gemeinsamkeit an Wertvorstellungen auf breitester Basis in unserer Gesellschaft nicht mehr gibt". Die Werte des Abendlandes seien nicht mehr unbestritten in Geltung, schon gar nicht weltweit, so der Leitende Bischof in seinem Bericht.
Der Catholica-Beauftragte der VELKD, Landesbischof Dr. Johannes Friedrich (München) stellte seinen Bericht unter das Thema "Zum gemeinsamen Zeugnis gerufen". Dabei griff er noch einmal die Studie “Communio Sanctorum - Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen” auf, die eine Bilaterale Arbeitsgruppe der Kirchenleitung der VELKD und der katholischen Deutschen Bischofskonferenz im September letzten Jahres veröffentlichte. Landesbischof Friedrich betonte, dass es sich bei dem Text, der u. a. auch Aussagen über das Papstamt enthält, um ein Diskussionspapier handle. Nach seinen Worten dürfe die Ökumene nicht daran scheitern, "dass wir nicht über den Papst diskutieren". Die Frage der römisch-katholischen Kirche nach der Bereitschaft der Lutheraner, über das Amt des Papstes in ein Gespräch einzutreten, löse bei ihm keine Denkblockaden aus, so Friedrich. Aus evangelischer Sicht habe sich die Debatte aber an folgenden Kriterien zu orientieren: Grundvoraussetzung sei, dass die römisch-katholische Kirche die anderen Kirchen als voll gültige Kirchen anerkenne. "Ausgeschlossen ist für uns ein Lehramt mit dem Anspruch der Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Moral", betonte der Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. "Wenn der Papst Sprecher der Weltchristenheit wäre, könnte er für die ökumenische Gemeinschaft nicht oberste Rechtsinstanz sein, könnte also für diese keine Jurisdiktionsgewalt haben." Zudem müsse er in dieser Funktion in kollegiale Strukturen eingebunden sein, "also in ein Kollegium, zu dem etwa der Präsident des Lutherischen Weltbunde, der Patriarch von Konstantinopel, der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen und der Erzbischof von Canterbury gehören sollten". Darüber hinaus müsse der Papst dann auch in synodale Strukturen eingebunden sein, die das Mitbestimmungsrecht der Laien gewährleisteten. Schließlich müsse der Papst dann auch in subsidiäre Strukturen eingebunden sein. Dies heiße, die Entscheidungsebene müsste von Zentralismus wegführen und regionale und nationale Entscheidungskompetenzen vorsehen. Diese Punkte müssten jedoch erst in der katholischen Kirche diskutiert werden, ehe das ökumenische Gespräch hierüber weitergehen könne.
Zu einer "vertieften sozialethischen Ökumene" zwischen der evangelischen und der römischkatholischen Kirche hat der Hildesheimer katholische Bischof Dr. Josef Homeyer aufgerufen. In seinem Grußwort sagte Homeyer, diese Einladung gehe aus "von dem Menetekel des 21. Jahrhunderts, dem 1 1 . September". Die Katastrophe dieser Massenvernichtung sei zu Recht auch als Anschlag auf die Freiheit und die Zivilisation verstanden worden. Die westliche Welt steht nach den Worten des Bischofs nicht nur in der Gefahr äußerer Bedrohung, sondern auch innerer Erosion, weil die Spannung zwischen Freiheit und Verbindlichkeit zur Krisenerscheinung geworden sei.
Zum Abschluss ihrer Beratungen betonte die Generalsynode in einer Stellungnahme zu Fragen der Bioethik den Grundsatz, "dass bereits der menschliche Embryo eine Würde hat". Deshalb müsse der Embryo "allen willkürlichen Zugriffen entzogen sein". In dem Beschluss lehnt die Generalsynode die verbrauchende Embryonenforschung, das Klonen von Menschen sowie Keimbahnmanipulationen ab. Wegen der "großen Missbrauchsmöglichkeiten" lehnt sie ferner "zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine gesetzliche Zulassung der Präimplantationsdiagnostik (PIO) ab". Zudem hat sich die Generalsynode ein Votum der Bischofskonferenz der VELKD vom 20. Oktober 200 I zur Lage nach den Terroranschlägen in den USA unter dem Titel "Menschen schützen, Gewalt überwinden" zu eigen gemacht. Darin wird u. a. die Notwendigkeit der Ächtung jeglicher terroristischer Handlungen unterstrichen sowie der Vorrang der Politik, des Dialogs und der humanitären Hilfe vor jeglicher militärischer Aktion bekräftigt.
Der vorliegende Protokollband "Lutherische Generalsynode 200 1 " unterrichtet Sie ausführlich über den Verlauf sowie die Ergebnisse der Beratungen in Bückeburg. Er dokumentiert neben den Berichten auch die Vorträge zum Schwerpunktthema der Generalsynode.