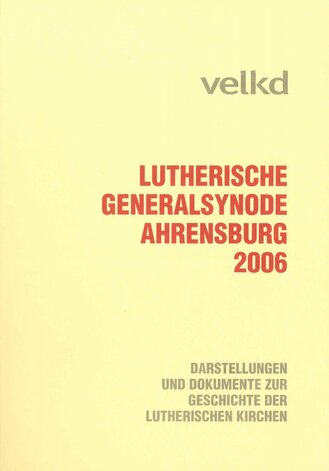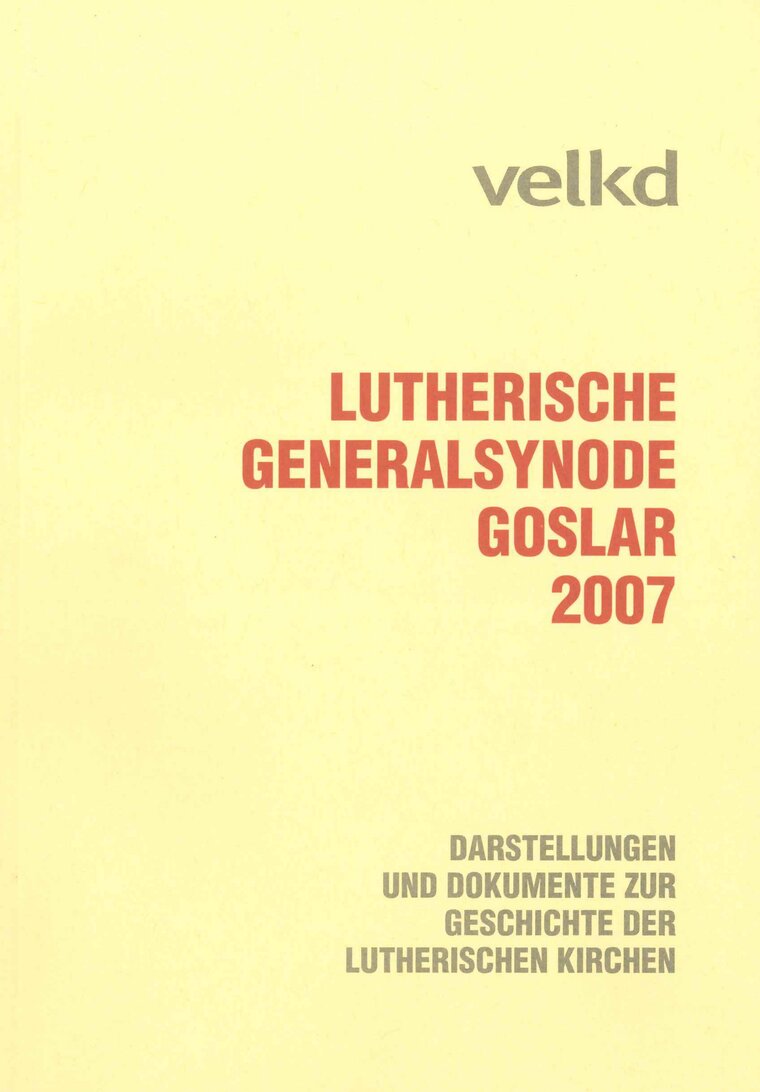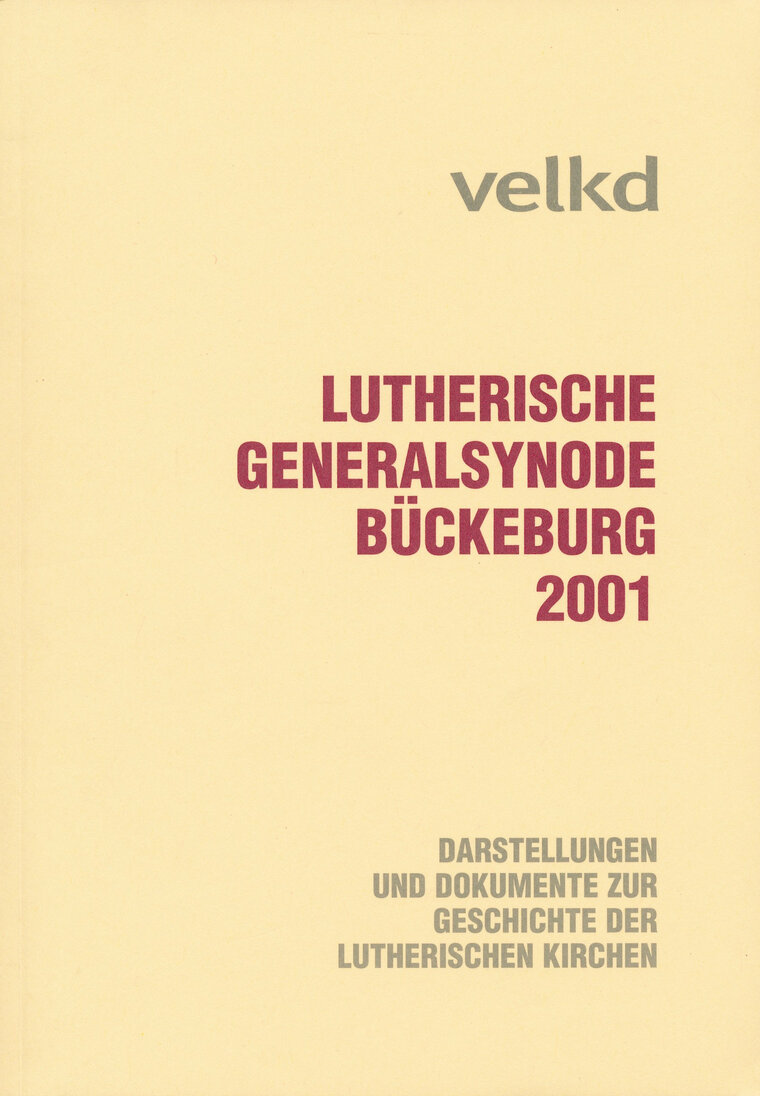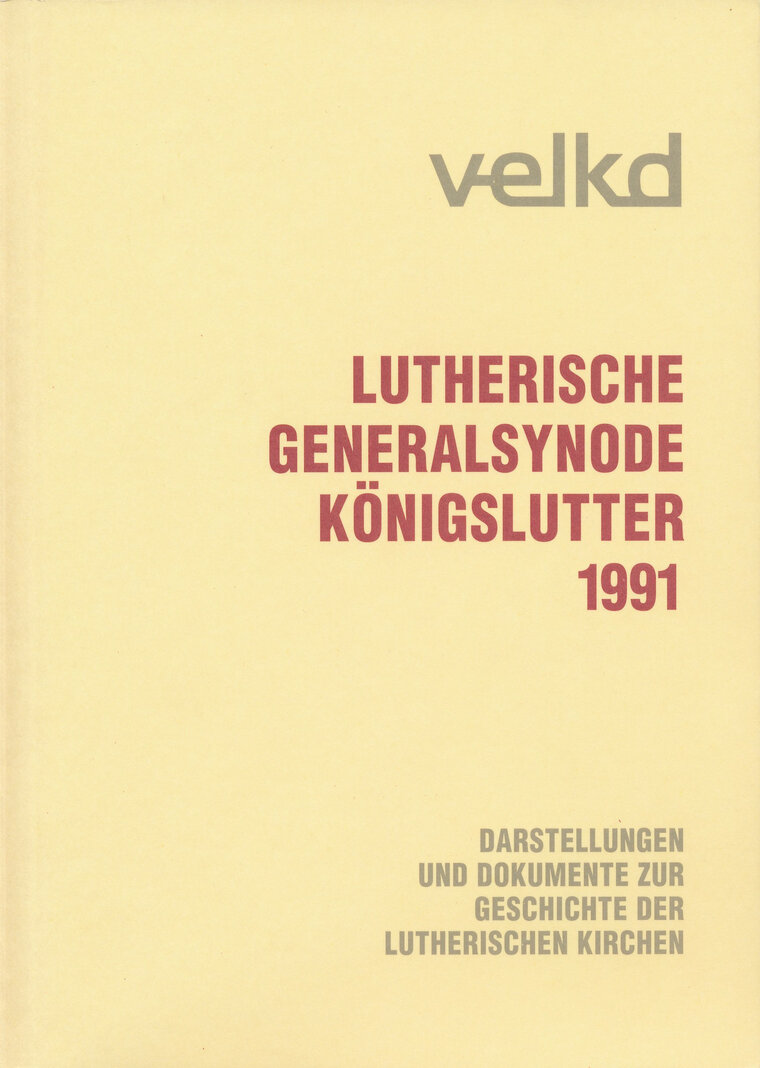Lutherische Generalsynode Ahrensburg 2006
Darstellungen und Dokumente zur Geschichte der Lutherischen Kirchen
Bericht über die vierte Tagung der zehnten Generalsynode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands vom 14. bis 18. Oktober 2006 in Ahrensburg bei Hamburg
- Reihe
- Protokollbände der Generalsynode
- Ausführung
- Paperback
- Sprache
- Deutsch
- Seitenzahl
- 482
- Format
- 14,8 x 21,0 cm
- Veröffentlichungsjahr
- 2007
- Verlag
- Lutherisches Verlagshaus, Hannover
- ISBN Print
- 978-3-7859-0976-8
„Die Kirche steht und fällt nicht mit der Gestalt, an die wir uns gewöhnt haben. In der Kirche der Zukunft wird die Bereitschaft von Gemeindegliedern, das Leben der Gemeinde aktiv und ehrenamtlich mit zu gestalten, wieder eine größere Rolle spielen.“ Dies betonte der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Dr. Johannes Friedrich (München), in seinem Bericht vor der 4. Tagung der 10. Generalsynode der VELKD, die vom 14. bis 18. Oktober in Ahrensburg bei Hamburg unter dem Thema „Versammelt in Christi Namen – Gemeinde neu denken“ tagte. In einer Kirche des „Priestertums aller Getauften“ sollte dies „nicht überraschen oder gar erschrecken“, so der bayerische Landesbischof. Ehrlicherweise müsse man eingestehen, dass die damit einhergehende Konzentration auf die Kernaufgaben zwar in einer gewissen Spannung zu einer sich ausdifferenzierenden Welt stehe. Aber sie „birgt in sich sogar den Vorteil, die Hauptthemen des christlichen Glaubens klarer zur Geltung zu bringen“. Der Leitende Bischof beklagte, dass die Bedeutung des Glaubens für die alltäglichen Entscheidungen und auch für die gesellschaftlichen Perspektiven abgenommen habe. Welches Potenzial der Glaube an Lebenshilfe in Krisensituationen gerade heute habe, sei vielen Menschen nicht mehr bewusst. Die Vertrautheit mit der Sprache des Glaubens und mit den prägenden Bildern der biblischen Geschichten schwinde. Das „Feuer des Glaubens“ sei bei vielen Menschen klein geworden, bei manchen sogar ganz erloschen. Es sei, als wenn der „Platzregen des Evangeliums“ vorbei gezogen sei und wir in einer Dürrephase lebten. Es erfülle ihn mit Sorge, wenn er daran denke, was die Menschen verlören, wenn Trosttexte wie „Der Herr ist mein Hirte“ oder „Befiehl du deine Wege“ nicht mehr zum Allgemeinwissen gehörten, räumte Landesbischof Friedrich ein. „Wir brauchen in der Gesellschaft wie in den Familien Menschen, die bezeugen, dass ihnen das Wort Gottes etwas bedeutet, dass es ihnen geholfen hat und weiterhin hilft und dass es ihnen Kraft gibt für ihren Lebensalltag.“ Von solchen Leitbildern erhoffe man sich einen Aufschwung in den Gemeinden. Die evangelische Kirche steht nach den Worten des Leitenden Bischofs der VELKD „vor der Notwendigkeit, die Gestaltungsformen unseres Christseins zu überdenken und Korrekturen vorzunehmen, um unserem Auftrag angesichts veränderter Rahmenbedingungen besser gerecht werden zu können“. Dabei dürfe es weder einen hierarchischen oder bürokratischen Zentralismus geben, der die Bedeutung der Gemeinden schmälere noch dürfe sich die einzelne Gemeinde isolieren. Die Wahrheit des Glaubens vermittele sich primär über persönliche Glaubenszeugen. Deshalb müssten sich kirchliche Reformmodelle daran messen, ob sie die möglichst breite Berührungsfläche mit den Menschen förderten oder gefährdeten.
Das Thema „Ökumene“ ist nach Ansicht des Catholica-Beauftragten der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Landesbischof Dr. Friedrich Weber (Wolfenbüttel), „vielfach spürbar an den Rand geraten, wird der Vollständigkeit halber mit erwähnt, aber nicht gedanklich ausgestaltet“. Vor der Generalsynode sagte er, eigentlich solle die Ökumene all unser Denken, Reden und Handeln bestimmen. In der Praxis auf Gemeindeund Kirchenkreisebene könne es jedoch immer wieder geschehen, dass weniger ökumenisch gestaltet werde, weil an die geringere Zahl von Priestern bzw. Pfarrerinnen und Pfarrern höhere Anforderungen im jeweils eigenen Kirchenbereich gestellt würden. „Ökumene wird dann mitunter eher als eine Aufgabe eingeschätzt, die man zwar schweren Herzens, aber leichten Gewissens auch einmal zurückstellen kann.“ Weber würdigte den lutherisch/römisch-katholischen Dialog, der seit den siebziger Jahren zahlreiche Dialogergebnisse hervor gebracht habe. Damit sei eine Basis geschaffen worden, auf die man aufbauen könne. Zugleich bestehe aber die Gefahr, zuerst den Überblick und dann die Kenntnis im Einzelnen zu verlieren. Ursache hierfür sei, dass es – mit Ausnahme der Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre zwischen dem Lutherischem Weltbund und der römisch-katholischen Kirche von 1999 – „keine geordnete Rezeption“ gegeben habe. In seinem Catholica-Bericht betonte der braunschweiger Landesbischof gleichwohl, dass die ökumenische Bewegung „gegenwärtig und künftig gute Chancen“ habe, „wenn wir sie nicht behindern, indem unseren Kirchen zu wenig zugetraut und zugemutet wird oder indem die Beteiligten versuchen, die jeweils andere Seite nach ihrem Bild zu gestalten“. Alle ökumenische Arbeit habe nicht nur die Verheißung und den Auftrag Jesu für sich, sondern auch die tiefe Einsicht, dass Gott mehr gewirkt habe und wirke, als eine Tradition oder Konfession aufgenommen habe oder ihm schon hinreichend Raum gebe. „Diese Einsicht lehrt uns, das eigene Glaubensgut im Zusammenhang der weltweiten Christenheit zu sehen, neu zu sehen und das ökumenische Potenzial zu entdecken.“ Neben einer „Ökumene der Profile“ sei es sinnvoll, auch von einer „Ökumene des Lebens“ zu sprechen, um die Arbeit der Gemeinden vor Ort in den Blick zu nehmen.
Die Kirchen haben in der Gesellschaft „nur eine Chance, wenn wir uns nicht über alte Gegensätze definieren wollen, sondern gemeinsam das unterscheidend Christliche vor den Menschen vertreten“. In seinem Grußwort vor der Generalsynode sagte der Hamburger Weihbischof Dr. Hans-Jochen Jaschke, „in der gemeinsamen Diaspora unserer Zeit sind wir stark, wenn Menschen spüren, dass wir nicht auf Kosten der anderen das Eigene behaupten wollen, wenn wir uns an die Hand nehmen und einander ergänzen“. Einigkeit mache stark – und nur gemeinsam seien die Kirchen stark. Als langjährigem Ökumeniker tue es ihm weh, wenn der inzwischen erreichte Konsens ins Gerede komme. „Wir sind so weit voran gekommen, auch im Bemühen um eine gemeinsame Sprache, dass wir eine unverlierbare Basis haben müssten.“ Die Rede von dem jeweiligen Profil wirke auf ihn „eher wie ein Rückzug mit Zügen einer Verweigerungshaltung“. Sein Wunsch an die Generalsynode: „Verlieren wir uns nicht aus dem Blick! Haben wir uns weiterhin gern in Respekt und Sympathie: So wie wir sind, aber auch so, wie wir sein könnten.“
Die lutherischen Kirchen spielen in der weltweiten Ökumene eine zentrale Rolle. Diese Auffassung vertrat der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes (LWB), Pfr. Dr. Ishmael Noko (Genf), vor der Generalsynode. Angesichts der vielfältigen Verbindungen zu anderen Konfessionen in allen Erdteilen komme den Lutheranern in einer künftigen ökumenischen Weltversammlung eine „entscheidende Rolle“ zu. Der LWB wolle sich aktiv an der Debatte um eine Neustrukturierung der ökumenischen Bewegung beteiligen, so Noko in seinem Grußwort. Die nächste Vollversammlung 2010 in Stuttgart bezeichnete er als „Meilenstein für die Zukunft des Lutherischen Weltbundes“. Sie werde zwar als „lutherische Vollversammlung“ geplant, es werde aber über die künftige Ausrichtung und Gestalt entschieden werden. An dieser Urteilsbildung würden auch Vertreter der anglikanischen, methodistischen und reformierten Kirchen sowie des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) beteiligt.
Zum Thema der Generalsynode führte die Hamburger Privatdozentin Dr. Uta Pohl-Patalong aus: In Deutschland schwinde die bisher „selbstverständliche christliche Grundierung der Gesellschaft“. Der Traditionsabbruch sei in Ostdeutschland viel stärker ausgeprägt als in Westdeutschland, aber auch in den alten Bundesländern inzwischen überdeutlich. „Konnte man früher von verbreiteten christlichen Grundhaltungen ausgehen, auch wenn Menschen nicht am kirchlichen Leben teilnahmen, wird heute immer deutlicher, dass christlicher Glaube auch eine Frage christlicher Bildung ist, die immer weniger selbstverständlich in den Familien und Schulen geleistet wird.“ Damit wird nach Meinung der Theologin, die derzeit in Kiel den Lehrstuhl für Praktische Theologie vertritt, der Kontakt zur Institution Kirche entscheidender für die Frage von Glauben und Gottesbeziehung, als dies in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen sei. Die Kirche müsse noch stärker daran interessiert sein, dass die Menschen in Kontakt mit ihr lebten.
Für einen intensiven Dialog zwischen den Kirchen und der Politik hat sich Ministerpräsident Peter Harry Carstensen auf dem Empfang der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und des Landes Schleswig-Holstein anlässlich der Generalsynode der VELKD ausgesprochen. Politik und Kirche sollten sich gemeinsam um die Probleme in der Gesellschaft bemühen, so Carstensen. „Den Kirchen kommt dabei die besondere Verantwortung zu, die christlichen Werte zu erhalten“, sagte der Ministerpräsident vor rund 200 Gästen im Kulturzentrum „Marstall“. Aufgabe der Politik sei es, die christlichen Werte vor politischen und rechtlichen Einschränkungen zu schützten.
„So viel Evangelium wie möglich – so viel Ökonomie wie nötig.“ Dieser Leitmaßstab soll nach Auffassung der Generalsynode kirchliches Handeln auf allen Ebenen bestimmen. In einem zwölf Thesen umfassenden Papier „Zur Zukunft der Gemeinde“ empfiehlt die Generalsynode, dass bei allen Reformbemühungen theologische Grundsätze die ökonomischen Entscheidungen bestimmen. Aktuell sei die evangelische Kirche stärker als bisher gefordert, neue Formen des Organisationsmanagements für sich in Anspruch zu nehmen sowie neue, von Kirchensteuermitteln unabhängige Wege der Finanzierung ihrer Arbeit – wie etwa Fundraising – zu finden. Auch einer professionellen Öffentlichkeitsarbeit komme wachsende Bedeutung zu. In der einstimmig verabschiedeten Entschließung weisen die 62 Vertreterinnen und Vertreter aus den acht Gliedkirchen der VELKD darauf hin, dass eine „viel zu wenig genutzte Chance“ darin liege, „wenn Ehrenamtliche mit ihren besonderen Kompetenzen an verantwortlicher Stelle bei der Wahrnehmung kirchlicher Aufgaben tätig werden“. Darüber hinaus ermutigt die Generalsynode, die Veränderungsprozesse in der Kirche aktiv mit zu gestalten. Die gegenwärtige Bedeutungs- und Finanzkrise zwinge zur Besinnung auf die Kernaufgabe der Kirche – „die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament“.
Der vorliegende Protokollband „Lutherische Generalsynode 2006“ unterrichtet ausführlich über den Verlauf sowie die Ergebnisse der Beratungen in Ahrensburg. Er dokumentiert u. a. auch die Berichte des Leitenden Bischofs sowie des Catholica-Beauftragten.